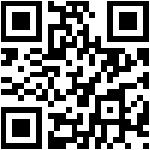Achtung! Interne Links (insbesondere auf Bilder) führen auf die Vollversion der Webseite.
AS — Atomspektren
Betreuer: Manfred Beckers (netter + hilfsbereiter Kerl)
- Was ist das zentrale Problem bei der Atommodellbeschreibung nach dem klassischen Prinzip? Welche zwei Postulate stellte Bohr deshalb auf?
- Gleichung für die Berechnung der Wellenlänge! Welche Konstante tritt dabei auf? Wie groß ist ihr wert? (In der Aufgabenstellung geht es noch um die Herleitung, der Betreuer will diese aber nicht wissen)
- Was für Effekte haben eine Auswirkung auf die Linienbreite? Welcher der fünf Effekte hat die dominierende Rolle?
- Was sagt die Intensitätsverteilung aus? Es ist eine Skizze unter Berücksichtigung einer endlichen Linienbreite anzufertigen!
- Wie ist das Auflösevermögen definiert? Skizze vom maximal noch aufzulösenden Grenzfall. Was kann man zur Verbesserung des Auflösevermögens tun?
Betreuer: Frob
-
Welche Punkte haben Einfluß auf die Linienbreite?
(In 2 Gruppen einorden; da nimmt man am besten 2 in Gruppe vom Gert und die restlichen drei sind mehr so im atomaren Bereich; dann den 5 Dingern noch eine Reihenfolge geben; welches den dominanten Einfluß hat und welches den geringsten (geringster ist natürliche Spaltbreite) und die dazwischen auch anordnen)
-
Wieso stellt man das Fernrohr auf unendlich ein?
(Nicht wegen der Entspannung des Auges sondern weil man Parallelstrahlen braucht da ansonsten ein zusätzlicher Fehler bei der Interferenz am Gitter entsteht)
- Wenn die Strahlen nicht parallel sind von was hngt das Auflösngsvermögen ab?
- Wenn man nich mehr das Fernrohr nutzen will, wie sieht dann der Aufbau des Versuchs mit künstlichem Detektor aus? Von was hängt dann noch das Auflösevermögen ab?
Betreuer: Röntzsch (netter Mensch)
-
- Nennen Sie die 3 Beiträge zur Linienbreite einer Metalldampflampe!
- Geben sie die Größenordnungen der Einflüsse an!
- Gegeben ist eine Gitterkonstante, ein gemessener Winkel und die Beugungsordnung. Berechnen Sie bei der Balmerserie welchen Quantenzustand das angeregte Elektron hat.
- Gegeben ist die Auflösung des Spektrometers λ÷(δ·λ)=5·10−5 (Wert kann auch anders gewesen sein). Berechnen Sie bis zu welcher Energie (Quantenzustand) man theoretisch beobachten kann, also Trennung von zwei Linien noch möglich ist.
Hinweise:
Der Versuch ist ziemlich umfangreich. Man kann die Justierung, alle Messungen und eine gute Auswertung eigentich nicht ganz schaffen (sagt selbst der Betreuer). Also zügig arbeiten. Am Anfang kontrolliert der Betreuer nochmals mündlich anhand der Testatfragen, ob die theoretischen Grundlagen vorhanden sind (ist aber nicht schlimm, wenn man nicht alles weiß).
Zu Frob:
War allgemein nicht so schwer der Versuch, wenn man das Testat geschafft hat. Ihm geht es nicht um die Noten sondern eher darum, dass man es verstanden hat. Daher auch das Hammertestat, das man eigentlich nicht durch Lesen der Bücher und des Praktikumheftes richtig haben, da die Frage 2 hauptsächlich eigentlich gar nicht so richtig im Praktikumsheft vorkommt. Er benotet aber gut weil er selbst weiß, dass das Testat schwer ist.
Zu Röntzsch:
Man kann zum Test alles verwenden (eigene Aufzeichungen, Praktikumsheft, Tafelwerk, Taschenrechner). Die 3. Aufgabe ist dafür etwas komplifiziert. Die schlechte Nachricht, dieser Versuch ist echt nichts für Blindfische; bei der Aufnahme der Balmerserie sollte man schon ein gutes Sehvermögen haben. Der Betreuer berücksichtigt dies aber.