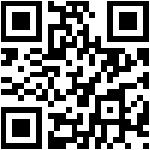Achtung! Interne Links (insbesondere auf Bilder) führen auf die Vollversion der Webseite.
HB — (Äußerer) Lichtelektrischer Effekt
Betreuer: Dierkes (vor- und nachmittags)
(Testat ist Rechenaufgabe, Formeln wissen ist notwendig! Alle nötigen Konstanten gibt es auf dem Aufgabenzettel)
-
Natrium emittiert bei Bestrahlung Licht einer maximalen Wellenlänge von 540nm.
- Berechnen Sie die Ablösearbeit von Natrium.
- Berechnen Sie die maximale kinetische Energie der freigesetzten Elektronen, wenn Natrium mit Licht der Wellenlänge 400nm bestrahlt wird.
-
Aluminium wird mit Licht der Wellenlänge 244nm bestrahlt. Bei der Gegenfeldmethode ist eine Gegenspannung von 1,0 V erforderlich, damit der Photostrom IPhot=0 ist.
- Berechnen Sie die Ablösearbeit von Aluminium
- Welche Wellenlänge muss das Licht haben, wenn eine Gegenspannung von 1,5 V angelegt werden muss, damit IPhot=0 ist?
- Berechnen Sie die maximale kinetische Energie (in Joule) eines Elektrons, das aus der Ruhelage heraus über eine Spannungsdifferenz von 15 V beschleunigt wird. Geben Sie ebenso die Endgeschwindigkeit an.
Betreuer: Keller (nachmittags)
- Skizzieren Sie das Potentialtopfmodell der freien Elektronen im Metall. Wie ist die Austrittsarbeit definiert? (3 Punkte)
- Warum haben nicht alle herausgelösten Elektronen die gleiche kinetische Energie, obwohl doch mit monochromatischem Licht bestrahlt wird? (1 Punkt)
- Nennen Sie 3 Mechanismen durch die Elektronen aus der Oberfläche von Festkörpern herausgelöst werden können. (3 Punkte)
- Was ist der Unterschied zwischen innerem und äußerem photoelektrischem Effekt? (2 Punkte)
- Wie kann man auf das Kathodenmaterial der Fotozelle schließen? (1 Punkt)
- Welchem deutschen Physiker wurde für die Deutung des photoelektrischen Effekts 1921 der Nobel-Preis verliehen? (1 Zusatzpunkt)
Hinweise
Falls der Betreuer es nicht erwähnt: Der Interferenzfilter muss lückenlos an den Kasten mit der Photozelle rangeschoben werden, so dass kein Licht eindringen kann. Den Photozellenkasten an sich evtl. mit dem rumliegenden Deckel abschirmen, damit kein Licht durch Ritzen eindringen kann.
Bei der Messung von IPhot(UG) sollte man zwei kleine Blendöffnungen nehmen (evtl. 2,1mm & 3,1mm), da ab 6mm scheinbar die Anode mit belichtet wird, die Linearität verloren geht und die Ergebnisse stark von UG, 0 stark voneinander abweichen.